„Ich will sagen, dass beschleunigte Prozesse dort problematisch werden, wo sie unser Weltverhältnis so verändern, dass dieses zu Entfremdung führt.“ – Hartmut Rosa in Deutschlandradio Kultur, 2016
Wer sich oft gehetzt fühlt oder das Gefühl kennt, innerlich auszubrennen, findet bei den Überlegungen des Soziologen Hartmut Rosa zwar keine schnellen Lösungen, aber eine Sprache für genau diese Erfahrung – und Impulse, das eigene Verhältnis zur Zeit, zur Welt und zu sich selbst neu zu überdenken. Im 3. Semester meines Studiums bin ich durch eine Soziologie-Vorlesung auf seine Texte gestoßen. In seinem Essay „Beschleunigung und Entfremdung – Entwurf einer kritischen Theorie spätmoderner Zeitlichkeit“ (2005) setzt sich der Soziologe mit der Frage auseinander, warum sich heute so viele Menschen gestresst, fremdbestimmt oder innerlich leer fühlen, obwohl es westlichen Gesellschaften objektiv gesehen noch nie so gut ging. Anstatt sich idealistisch am „guten Leben“ abzuarbeiten, formuliert er seine zentrale Frage anders: „Warum haben wir eigentlich kein gutes Leben?“
Rosas Ausgangspunkt ist einfach: Die moderne Gesellschaft ist nicht nur schnell, sie ist von einem bestimmten „Zeitregime“ durchdrungen, einem unsichtbaren Takt, der unsere Tage strukturiert und beschleunigt. Er geht zunächst davon aus, dass unser persönliches und gesellschaftliches Leben unter den gegenwärtigen Bedingungen dringend reformbedürftig ist. Ob Deadlines, To-do-Listen oder der Zwang, ständig erreichbar zu sein – diese Dinge mögen uns mittlerweile alltäglich und vertraut vorkommen, für Rosa sind sie Ausdruck eines umfassenden gesellschaftlichen Systems, das kaum noch bewusst wahrgenommen oder hinterfragt wird. Soziale Beschleunigung führt nach Rosa „in ihrer gegenwärtigen, totalitären Form zu schwerwiegenden und empirisch beobachtbaren Form der sozialen Entfremdung, die als die größten Hindernisse begriffen werden können, die der Verwirklichung einer modernen Konzeption des guten Lebens in spätmodernen Gesellschaften entgegenstehen.“
Rosa unterscheidet in seinem Essay drei zentrale Formen sozialer Beschleunigung: die technische Beschleunigung (z. B. durch schnelle Kommunikationsmittel oder Verkehrssysteme), die Beschleunigung des sozialen Wandels (etwa durch häufige Jobwechsel oder sich wandelnde Beziehungsformen) und die Beschleunigung des Lebenstempos – das Gefühl, nie genug Zeit zu haben, das zur ständigen Begleitmusik des Alltags wird. Diese drei Formen stehen nicht nebeneinander, sondern verstärken sich gegenseitig – diesen Prozess beschreibt Rosa als „Beschleunigungszirkel“. Was diesen zusätzlich antreibt, sind zwei große Kräfte: der globale Wettbewerb (ökonomisch) und das kulturelle Versprechen, dass Schnelligkeit letztlich Glück und Sicherheit bringt.
Letzteres wird allerdings in der Realität nur allzu oft enttäuscht – in seiner Analyse greift Rosa den klassischen und zentralen Begriff der Entfremdung aus der Sozialtheorie auf, um zu beschreiben, wie der genannte Beschleunigungszirkel Menschen letztlich negativ beeinflusst. Der Begriff stammt ursprünglich von Karl Marx, der ihn im „Ökonomisch-philosophischen Manuskript“ (1844) wie folgt definierte: „Die Entfremdung des Arbeiters in seinem Produkt bedeutet nicht nur, dass seine Arbeit Gegenstand wird, eine äußere Existenz gewinnt, sondern dass sie außerhalb seiner, unabhängig von ihm besteht, und dass sie zu einer selbständigen Macht gegenüber dem Arbeiter wird.“ Damit beschrieb Marx vor allem das Verhältnis zwischen Arbeit und Arbeiter im Kapitalismus. Rosa greift diese Idee auf und weitet sie aus. Entfremdung meint für ihn einen Verlust gelingender Weltbeziehungen. Menschen fühlen sich fremd gegenüber ihrer eigenen Tätigkeit, gegenüber Dingen, gegenüber der Zeit und gegenüber sich selbst.
Als Gegenbegriff entwickelt er das Konzept der Resonanz: das Gefühl, mit der Welt verbunden zu sein, mit ihr in einem echten, wechselseitigen Austausch zu stehen. Resonanz ist nach ihm dabei nicht zu verwechseln mit Harmonie im Sinne von Wellness oder Esoterik, sondern bedeute, „dass mich etwas berührt und verändert und ich darauf antworte und reagiere“. In einer hochbeschleunigten Welt wird Resonanz laut dem Soziologen jedoch immer seltener – darin sieht er das Kernproblem, das dem guten Leben im Weg stehe. Das Konzept der Resonanz soll also kein einfaches Rezept für ein besseres Leben darstellen, sondern beschreibt, worauf es ankommt, wenn Menschen Beziehungen führen wollen, die nicht nur funktionieren, sondern auch etwas bedeuten. Es geht um Berührbarkeit, um Offenheit und Antwortfähigkeit.
Eine der provokantesten Thesen Rosas ist der bereits genannte Vergleich sozialer Beschleunigung mit totalitärer Herrschaft. Damit ist nicht die politische Diktatur gemeint, sondern eine systemische Fremdbestimmung, die so tief ins Leben eingreift, dass sie sich demokratischer Kontrolle entzieht. Der beschriebene Zwang zur Beschleunigung wäre demnach kein individueller Wunsch, sondern strukturell verankert. Rosa wagt zu behaupten, dass nirgendwo außerhalb der westlichen Moderne Alltagspraktiken so konsequent durch eine „Rhetorik des Müssens“ strukturiert sind. Das sei eine logische Konsequenz des Wettbewerb orientierten Beschleunigungsspiels, welches die Menschen in einem immer schneller rotierenden Hamsterrad gefangen halte und zur Entfremdung führe.
Rosa beschreibt diesen Prozess so: „Die Beschleunigung übt ihren Druck auf die Subjekte zunächst so aus, dass diese in ständiger Furcht davor Leben, auf den (im Zuge wachsender Ausdifferenzierung immer zahlreicher werdenden) Abhängen des Lebens nicht mehr in der Lage zu sein, auf dem Laufenden zu bleiben und damit ihren Platz zu halten; dass sie zurückfallen, nicht mehr mitkommen oder „abgehängt“ werden und daher aus dem Hamsterrad exkludiert werden, weil sie zu langsam sind oder eine Pause brauchen.“ Und weiter: „Jene die etwa durch Krankheit oder Arbeitslosigkeit geprägt sind, haben die Angst, dass sie an das Rennen keinen Anschluss mehr finden werden, dass sie bereits zurückgefallen sind. Wenn diejenigen, die von privilegierten Positionen aus und mit einer guten Ausstattung das Rennen aufnehmen, bereits so schnell sie nur könne laufen und alle verfügbare Energie investieren müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, dann hat es für jene, die bereits mit einem deutlichen Rückstand ins Rennen gehen, überhaupt keinen Sinn, den Kampf aufzunehmen. (…) Dieses Zwangsregime wird in aller Regel nicht als sozial konstruiert wahrgenommen. Zeit wird noch immer als eine bloße Naturtatsache erfahren, und die Menschen machen sich selbst für ihr schlechtes Zeitmanagement verantwortlich, wenn sie den Eindruck haben, die Zeit laufe ihnen davon.“
Der Essay „Beschleunigung und Entfremdung” wurde in den Sozialwissenschaften breit rezipiert. Rosas Ansatz gilt als einer der originellsten Beiträge zur Gegenwartsdiagnose. Kritisch äußerte sich u. a. Thomas Gross in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung” (2013). Ihm zufolge bleibe Rosa theoretisch zu vage und entwickele sein Modell nicht konsequent weiter. Dem lässt sich entgegnen, dass dies auch nie der Anspruch dieses Essays war – Rosa selbst bezeichnet ihn als „Entwurf“, den er später in „Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung“ (2016) systematisch weiterentwickelt.
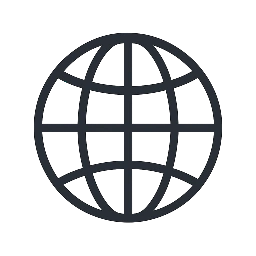

Schreibe einen Kommentar